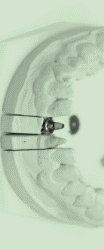Anders als die speziell auf medizinisch-wissenschaftliche Artikel gemünzten Beschreibungen im unteren Tabellenabschnitt beruhen die Kategorien im oberen Abschnitt auf klaren Definitionen aus dem Chicago Manual of Style. Diese Definitionen erlauben eine deutlich anschaulichere Leistungsbeschreibung, als sie uns früher gelungen ist. Zudem erscheinen vor ihrem Hintergrund gängige, aber schlecht definierte Benennungen wie Redaktion, Lektorat, Korrektorat (und in gewissen Fällen sogar Übersetzung) sehr weitgehend entbehrlich.
Ausführlicher behandeln wir diesen Themenkreis im nunmehr dritten Lesebereich dieser Internetseiten, Titel »Sinnvolle Maßstäbe«. Dieser befindet sich noch in Vorbereitung. Viele weitere relevante Inhalte für aktuelle und zukünftige Kunden bietet auch noch der Kernbereich mit unseren Leistungsbeschreibungen (siehe weiße Links hier oben).
© 2017-12-04 Wilfried Preinfalk. Alle Rechte vorbehalten.
Leistungen im Überblick
Die Tabelle in der Seitenmitte illustriert unser Leistungsspektrum auf einen Blick. Medizinisch-wissenschaftliche Artikel stehen dabei im Fokus. Die Aussagen in der Tabelle sind also nicht eins zu eins auf andere Textsorten (z. B. Vortragstexte, Buchartikel oder Bücher) übertragbar. Vieles lässt sich aber doch sehr gut verallgemeinern.
In den grünen Zonen finden wir uns häufig wieder, in den roten so gut wie nie. Die Tabelle enthält zahlreiche Erklärungen. Parken Sie einfach den Mauszeiger über den Texten (wer es weniger fummelig mag, findet hier einen alternativen Zugang). Inhalte verbergen sich auch hinter den Pfeilen und hinter der roten Vertikale rechts unten.
Hinweis. Das Stadium der Begutachtung (des »Peer Review«) klammert die Tabelle auf dieser Seite aus. Selbstverständlich bearbeiten wir auch solche Texte. Mehr zu Gutachtern und deren Maßstäben an die sprachliche Umsetzung medizinisch-wissenschaftlicher Artikel finden Sie ebenfalls im neuen Lesebereich »Sinnvolle Maßstäbe« (derzeit in Vorbereitung).
Allgemeingültige Bandbreite und Abfolge von Textbearbeitungen. Die im oberen Tabellenabschnitt benannten Kategorien (siehe Pfeile) sind eng an das Chicago Manual angelehnt. Jene im grünen Bereich bilden unser grundsätzliches Leistungsspektrum ab. Drei Botschaften aus dieser Kategorisierung sind uns wichtig: (1) Jede Textbearbeitung umfasst verschiedene Teilaufgaben, die an die Kompetenz der handelnden Person(en) unterschiedliche Anforderungen stellen. (2) Gerade bei komplexen Inhalten kann ein Zusammenführen mehrerer dieser Teilaufgaben in die Hände eines Einzelbearbeiters sehr gewinnbringend die Textkohärenz stärken und doppelte Gedankenarbeit einsparen; nur muss diese Person hierzu immer wieder die Perspektive wechseln und kann so punktuell »blinde Flecken« für kleine (in aller Regel geringfügige und keinesfalls als Nachlässigkeiten zu wertende) mechanische Fehler entwickeln; mit einem gewissen zeitlichen Abstand löst sich dieses Problem in aller Regel von selbst. (3) An die gezeigte Reihenfolge (siehe die horizontalen Pfeile) ist ein Einzelbearbeiter nur bedingt gebunden; arbeiten jedoch mehrere Personen am selben Text, geht bei jeder Abweichung von dieser Reihenfolge rasch die Übersicht verloren.
Erstautorschaft, Koautorschaften (und Sonderfall »Ghostwriting«). Diese Tabellenzone ist natürlich in Wirklichkeit viel breiter als hier suggeriert. Ihre rote Farbe soll verdeutlichen, dass wir uns hier so gut wie nie aufhalten. Konkret streben wir (a) keine Koautorschaften an und haben unsere Bearbeitungen (b) nichts mit »Ghostwriting« zu tun. Letzteres gilt auch für die »strukturelle« Bearbeitungsvariante (siehe nächster Tabellenpunkt rechts), die das Chicago Manual als developmental editing bezeichnet und dabei auf das gleichnamige Buch von Scott Norton verweist. Auch dort wird sofort eingangs klargestellt, dass »Ghostwriting« in eine Reihe etwa mit Koautorschaften zu stellen wäre und developmental editing damit nichts zu tun hat. Hierzu passend illustriert unsere Tabelle schön, warum man primär mechanische Tätigkeiten (rote Zone rechts) nicht als natürlich-direkte Fortsetzung aller Autorschaft begründenden Tätigkeiten (rote Zone links) betrachten sollte. Denn die genannten Zwischenkategorien sind höchst real. Ignoriert man sie oder tut sie als nebensächlich ab, führt dies in vielen Szenarien – egal an welchen Stellschrauben man sonst noch dreht – immer wieder in die gleiche Sackgasse mit den gleichen Qualitätsproblemen.
Pfeil – Übergang zur strukturellen oder/und sprachlichen Bearbeitung. Selbst erfahrene Autoren klagen darüber, dass sich in der Auseinandersetzung mit eigenen Manuskripten früher oder später ein »Tunnelblick« einstellt und zum Zeitpunkt der Einreichung beim Zieljournal längst eine gewisse »Betriebsblindheit« herrscht. Als mögliche Folge droht ein schleppender Begutachtungsprozess mit umständlichen Nachbearbeitungen, zumal viele Reviewer die Grenzen zwischen Inhalt, Struktur und Sprache in ihren Kritikpunkten bis zur Unkenntlichkeit verwischen. Immerhin handelt es sich um medizinische und nicht um linguistische (!) Gutachter. Nicht selten wird daher die Diagnose eines strukturell-sprachlich unfertigen Bearbeitungsstandes richtig gestellt, aber falsch argumentiert (oder schlecht artikuliert). Solche Reibungsverluste lassen sich durch eine professionelle Bearbeitung im Vorfeld der Einreichung meist vermeiden. Freilich erreicht man dadurch keine »Immunität« gegen jede (mit dem Rückenwind der Deutungshoheit geäußerte) Beanstandung. Dies zu behaupten wäre vermessen und zu erwarten unklug (ähnlich, um beim Bild zu bleiben, der Erwartung von Schnupfenfreiheit nach einer Grippeimpfung, wobei erfolgreich vermiedene Fälle hier wie da naturgemäß auch schwerer zu quantifizieren sind als eingetretene Fälle).
Strukturelle Bearbeitung
Links von hier in der Tabelle erklären wir die eindeutige Trennlinie zwischen dieser Bearbeitungsform und der Tätigkeit von Autoren, Koautoren oder gar »Ghostwritern«. Mehr zu diesem Thema – auch zur deutschen Wortwahl »strukturelle Bearbeitung« für developmental editing – wird der Lesebereich »Sinnvolle Maßstäbe« (in Vorbereitung) bieten. Exemplarisch für strukturelle Eingriffe wäre bei medizinisch-wissenschaftlichen Artikeln jedes Neuanordnen von Aussagen, Einführen von Zwischenüberschriften, Umgestalten von Absätzen oder Verschieben von Gliederungsebenen. Geradezu »prototypisch« ist das strukturierende Kürzen von Abstracts auf eine vorgegebene Wortzahl. Laut Chicago Manual of Style werden Texte beim developmental editing »im Extremfall völlig umgeschrieben«. Solche Fälle sind in unserer Auftragsstruktur eher selten, geschweige denn gelangen wir je auch nur in die Nähe eines »Ghostwriting«: Zwar drehen sich strukturelle Bearbeitungen nicht mehr ausschließlich um Sprache, aber immer noch ausschließlich um explizit oder implizit bereits vorgegebene Inhalte.
Pfeil – Übergang von struktureller zu sprachlicher Bearbeitung. Strukturell-sprachliche Bearbeitungen können sehr weitgehend auch ohne eine feste Reihenfolge der Arbeitsschritte auskommen, solange sie durch ein und dieselbe Person erfolgen. Tendenziell ist eine solche »Individualisierung« breiterer Bearbeitungen schon deshalb von Vorteil, weil sie gerade bei komplexen Inhalten (a) die Textkohärenz verbessern und (b) doppelte Gedankenarbeit einsparen kann. Erst bei Aufgabenteilung wird die Reihenfolge unverzichtbar. Etwa sollten nach Fertigstellung einer substanzorientierten Bearbeitung möglichst keine Struktureingriffe oder nach mechanischer Bearbeitung keine Substanzeingriffe mehr folgen. Anderes Beispiel: Professionelle Übersetzungen haben zum Zeitpunkt der Lieferung eine vernünftige mechanische Endbearbeitung bereits hinter sich. Somit können, aus den hier angerissenen Gründen, selbst noch kleinste nachträgliche Eingriffe durch die Autoren unangenehme Folgen haben. Bei der Begutachtung nämlich wird stets der »Makel« das Auge anziehen und potenziell, je nach Reviewer, in quantitativ unverhältnismäßiger Weise von der Gesamtschau ablenken. Wir bieten daher eine – in gezielten Grenzen kostenlose – Enddurchsicht.
Sprachliche Bearbeitung
Unter »sprachlicher Bearbeitung« verstehen wir dasselbe wie das Chicago Manual unter manuscript editing (auch copyediting oder line editing). In genau dieser Bedeutung hatten wir »sprachliche Bearbeitung« bereits in allen früheren Versionen dieser Internetseiten verwendet. Die genannte Parallele entdeckten wir erst später und fanden diesen Umstand umso erhellender, als er in der Verwendung der beiden Bezeichnungen als Überbegriff sogar noch eine Fortsetzung findet. Das Chicago Manual subsumiert nämlich zwei grundsätzlich verschiedene Tätigkeiten unter manuscript editing: substantive editing (hier früher »Redigieren«, nunmehr »substanzorientierte Bearbeitung«) und mechanical editing (früher »Lektorieren«, nun »mechanische Bearbeitung«). Neben dieser äußerst wichtigen Differenzierung zieht der Überbegriff auch eine deutliche Trennlinie zum bereits besprochenen developmental editing (hier, wie bereits erwähnt, »strukturelle Bearbeitung«).
Substanzorientierte Bearbeitung
Der Schwerpunkt unserer Arbeit liegt eindeutig genau hier. Dies kommt deutlich auch im unteren Abschnitt dieser Tabelle (siehe die gestaffelten Bandbreiten) zum Ausdruck. Wir werden daher im Rahmen dieser Internetseiten noch mehrere Male auf diesen Bearbeitungstyp zu sprechen kommen. Besonders wichtig ist der im Chicago Manual betonte Unterschied zwischen substantive editing (hier »substanzorientierte Bearbeitung«) und mechanical editing (hier »mechanische Bearbeitung«). Prinzipiell ist zu sagen, dass eine gute substanzorientierte Bearbeitung die nachgeordneten mechanischen Anforderungen sehr weitreichend bereits mit abdecken wird. Ebenso grundsätzlich stellen jedoch beide Tätigkeiten (a) ganz verschiedene Anforderungen an die Kompetenz der handelnden Person(en). Auch ist (b) die geistige Perspektive nicht dieselbe: Konzentration auf Substanz kann für manch mechanische Aspekte blind machen, und umgekehrt fällt dieser Effekt noch viel stärker ins Gewicht.
Eigene Erfahrungen mit medizinisch-wissenschaftlichen Artikeln
Unser Fazit aus 25 Jahren Erfahrung mit diesen Texten lautet, dass gute Resultate meist nur erreichbar sind, wenn man die Spanne der substanzorientiert-sprachlichen Bearbeitung komplett ausschöpft und darüber hinaus noch ein Stück weit in den Bereich der strukturellen Bearbeitung vordringt. Viele Übersetzer arbeiten ungern mit dieser Textsorte und begründen dies mit den »schlecht geschriebenen« Vorlagen. Zweifellos ist dieser pauschale Eindruck eine direkte Folge der Komplexitäten, die in aller Regel unter der Textoberfläche verborgen liegen. Dieser erschwerende Umstand hat mindestens noch zwei andere wichtige Konsequenzen: Zum einen klärt sich der notwendige Bearbeitungsumfang häufig erst mit der Arbeit am Text (ist also a priori nicht immer gut einschätzbar, was die Zeitplanung erschwert). Zum anderen erlebt man Auftraggeber mit resignativer Grundhaltung, die sinnvolle Ansprüche an eine sprachliche Bearbeitung gar nicht erst stellen. Dies kann so weit gehen, dass gute Arbeit eine gewisse Abwehrhaltung oder gar erschrockene Reaktionen auf sich zieht.
Einzelfall »freie Hand«
Nicht jeder Text erfordert eine Bearbeitung über die gesamte strukturell-sprachliche Bandbreite. Gibt uns ein Kunde »freie Hand«, ist dies ein ebenso willkommener wie motivierender Vertrauensbeweis, mit dem sich entsprechend gut arbeiten lässt. Und vielleicht stellt sich ja während der Bearbeitung heraus, dass der Aufwand durchaus im Rahmen bleibt. Diametral im Gegensatz hierzu stehen manche Kunden, die eine stark mechanistisch verengte Sicht auf unsere Tätigkeit erkennen lassen, während gerade ihre Texte dann womöglich einen immensen Recherche- und Denkaufwand verursachen. Übrigens finden wir offenere Erwartungen viel häufiger an einsprachige Bearbeitungen geknüpft als an zweisprachige. Man könnte es auch so ausdrücken, dass strukturell-sprachliche Gesamtbearbeitungen doch merklich den Rahmen dessen sprengen, was wir alle gemeinhin unter »Übersetzung« verstehen. Dabei würde bei objektiver Betrachtung – ohne diese »Schere im Kopf« – vieles (und in manchen Fällen alles) für zweisprachige Bearbeitungen über die gesamte Bandbreite sprechen.
Regelfall mit Struktureingriffen
Bandbreiten dieser Art sind für unseren Arbeitsalltag nicht untypisch und beschränken sich auch keineswegs auf einsprachige Aufträge: Viele zweisprachige Beabeitungen, die wir problemlos unter dem Titel »Übersetzung« abwickeln, erreichen diese Breite. Fast immer lassen sich die primär vorliegenden »Strukturdefizite« so erklären, dass der Bearbeitungsstand des Ausgangstextes nicht hinreichend fortgeschritten ist. Die anfallenden Struktureingriffe kann man sich so vorstellen, dass sich während der substanzorientierten Bearbeitung strukturelle Optimierungen quasi »aufdrängen«. Bei diesbezüglich unklaren Erwartungen eines Kunden betonen wir zunächst in einem Kommentar den Vorschlagscharakter der strukturellen Optimierung und bieten an, diese auf Wunsch kostenlos wieder »zurückzubauen«. Sollten Struktureingriffe aus prinzipiellen Erwägungen unerwünscht sein, nehmen wir klarerweise davon Abstand. Überhaupt befolgen wir stets die Vorgaben unserer Kunden (wobei präzise artikulierte Erwartungen leichter zu erfüllen sind als schweigend vorausgesetzte Erwartungen).
Regelfall mit minimalen Struktureingriffen
Unsere Unterscheidung zwischen »Regelfall mit Struktureingriffen« und »Regelfall mit minimalen Struktureingriffen« ist selbstverständlich nicht wörtlich zu verstehen. Wir möchten damit lediglich zum Ausdruck bringen, dass die sinnvolle Bandbreite an struktureller Optimierung von Text zu Text erheblich variieren kann. Auf unserem Spezialgebiet der medizinisch-wissenschaftlichen Artikel fallen ständig zweisprachige, noch sehr gut als »Übersetzungen« titulierbare Bearbeitungen an, die »minimale« Struktureingriffe nahelegen. Ein besonders häufiges Beispiel wäre das strukturierende Kürzen von Abstracts auf eine vorgegebene Wortzahl. Gerade bei Übersetzungen ins Englische sind solche Kürzungen sehr häufig erforderlich – schon deshalb, weil deutsche Wörter im Schnitt länger sind als englische Wörter, sodass Texte gleichen Inhalts im Englischen deutlich mehr Wörter umfassen als im Deutschen (umgekehrt liegt der Fall übrigens bei der Anzahl der Zeichen und somit der effektiven Textlänge).
Sonderfall »eigentliches Übersetzen«
Nun ließe sich natürlich trefflich darüber streiten, was eine »eigentliche« Übersetzung sein soll. Unseres Erachtens legen aber die (an das Chicago Manual angelehnten) Kategorien in dieser Tabelle eine sehr vernünftige Definition nahe. Dieser zufolge wäre die Mindestanforderung an Ausgangstexte für »eigentliches« Übersetzen ein inhaltlich, strukturell und sprachlich fortgeschrittener Bearbeitungsstand, der einen zügigen (für medizinisch-wissenschaftliche Übersetzungen stets in erster Linie substanzorientierten und nicht mechanischen) Arbeitsfluss ohne »sich aufdrängende« Eingriffe in die Struktur gewährleistet. Optimal wäre freilich ein Bearbeitungsstand, der noch weiter fortgeschritten ist und nicht mehr ununterbrochen das gesamte Potenzial des Übersetzers an substanzorientierter Tiefe fordert, sondern dem Ausgangstext bereits eine »aktive« sprachliche Substanz verleiht, die quasi aus sich heraus regelmäßig »Steilvorlagen« für korrekte und gut lesbare Umsetzungen liefert.
Sonderfall »rein mechanische Bearbeitung«. An wissenschaftliche Texte mit sprachlich-strukturellem Bearbeitungsstand in der roten Tabellenzone ganz links sollte man nicht die Erwartung einer unmittelbar sinnvollen Weiterbearbeitung in der roten Zone ganz rechts knüpfen. Dieser Trugschluss steht bereits vielen einsprachigen Bearbeitungen überdeutlich im Gesicht geschrieben, und nur diese können überhaupt »rein mechanisch« erfolgen. Wobei gerade dieser Punkt in unserem Fall sich wieder dadurch relativiert, dass wir sprachlich-strukturell fortgeschrittene Ausgangstexte bei einsprachigen Projekten (meist vom Englischen ins Englische) wesentlich seltener als bei zweisprachigen (meist vom Deutschen ins Englische) sehen. Übersetzen (durch Menschen) wiederum hat stets eine substanzorientierte Komponente, erfolgt also nie »rein mechanisch«; nicht zuletzt deshalb ist »rein mechanisches« Nachbearbeiten durch Dritte hier grundsätzlich sehr sinnvoll, muss sich aber logischerweise auf den Zieltext beschränken – sollte also, um »Tiefschläge in die Substanz« der Übersetzung zu vermeiden, keine »rein« (oder auch nur überwiegend) mechanische Abgleichung mit dem Ausgangstext umfassen oder gar eine Art »interventioneller Oberhoheit« für sich beanspruchen. Mehr hierzu noch im nächsten Tabellenpunkt (rote Vertikale).
Rote Vertikale. Fast jede »nicht rein mechanische« Bearbeitung hinterlässt Spuren mechanischer Fehlleistungen wie Tippfehler, Kongruenzfehler oder Wortauslassungen. Meist handelt es sich um vereinzelte und harmlose Effekte, aber selbst noch hinter sinnverändernden Extrembeispielen wie einem fehlenden »nicht« (oder »ein« statt »kein«) stehen nicht Denkfehler, sondern »blinde Flecken«. Isolierte Seltsamkeiten dieser Art sind nicht mit systematischen Verständnisfehlern zu verwechseln. Eher würde sich die Analogie eines Suchrätsels anbieten, das übrigens auch ein simples Vieraugenprinzip nicht mit der nötigen Zuverlässigkeit restlos wird auflösen können. Die gute Nachricht ist, dass unsere Auftragsstruktur (meist deutschsprachige Autoren und englischsprachige Zieltexte) ein besonders effektives Vieraugenprinzip impliziert, da diese Kunden die gelieferten Texte verstehen, mit Argusaugen lesen und bei Bedarf auch korrigieren. Die schlechte Nachricht: So wie bei »rein mechanischen« Abgleichungen mit Ausgangtexten »Tiefschläge in die Substanz« von Übersetzungen drohen (siehe Tabellenpunkt »rein mechanische Bearbeitung«), drohen bei »rein inhaltlichen« Eingriffen durch Autoren »Tiefschläge in die Sprache« des gelieferten Produkts. Wir bieten daher eine – in gezielten Grenzen kostenlose – Enddurchsicht.
Mechanische Bearbeitung. Vorweg zur Klarstellung: »Mechanisch« ist hier nicht mit »maschinell« oder »automatisiert« zu verwechseln (mehr zu diesem anderen Thema demnächst im Lesebereich »Sinnvolle Maßstäbe«). Vielmehr dienen mechanische Bearbeitungen in erster Linie der Konformität mit Regelwerken, die wir im Deutschen gern (aber doch sehr undifferenziert) als »Rechtschreibung« diskutieren, während im Englischen von einem style die Rede ist. Das Chicago Manual ist also keine »Stilfibel«, sondern kombiniert diverse Elemente, die wir aus dem Duden (namentlich aus dem Vorspann von Band 1 und aus Band 9) kennen. Abwertend kann »mechanische« Bearbeitung schon deshalb nicht gemeint sein, weil solche Regelwerke unendlich viel »Luft nach oben« für Faktenwissen (und natürlich Sprachgefühl) bieten. Trotzdem liegt der entscheidende Punkt nicht etwa in der (praxisfernen) Fähigkeit, solche »äußeren« Regelwerke quasi »bis aufs i-Tüpfelchen« einzuhalten (erschwerend kommt hinzu, dass oft mehrere ineinandergreifen – z. B. die Autorenrichtlinien eines Zieljournals den AMA Style überlagern). Wichtig ist vielmehr das »innere« Regelwerk der handelnden Person: Erst ein gewachsenes, schlüssiges System dieser Art befähigt zu »zügigen, logischen und begründbaren [!] Entscheidungen«, wie das Chicago Manual sie fordert.
Pfeil – Übergang von substanzorientierter zu mechanischer Bearbeitung. Eine professionelle substanzorientierte Bearbeitung wird, wie gesagt, die nachgeordneten mechanischen Anforderungen weitestgehend bereits mit abdecken. Zwischen Substanz und Mechanik ergibt sich – anders als zuvor zwischen Struktur und Substanz – eine gewisse zwingende Reihenfolge der Schritte schon insofern, als der substanzorientierte Einzelbearbeiter nicht nur implizit auch mechanisch agiert, sondern das Produkt seiner Tätigkeit zudem noch explizit korrekturlesen wird und diese Verrichtung, mitsamt dem ihr eigenen Perspektivenwechsel, selbst in ihrer reduziertesten Form (»Überfliegen« des Textes) immer nur am Schluss stehen kann. Arbeiten zwei Personen am selben Text, führt an der korrekten Reihenfolge (Substanz > Mechanik) sowieso kein Weg vorbei. Übersetzen durch Menschen (siehe hierzu auch den Einleitungssatz im nächsten Tabellenpunkt) hat stets eine substanzorientierte Komponente, sodass getrennte mechanische Nachbearbeitungen keinesfalls eine »mechanische« Kontrolle auf Übereinstimmung mit dem Ausgangstext beinhalten sollten. Überhaupt birgt jedes Delegieren solcher Kontrollen durch den federführenden Autor an andere Personen (zuweilen sogar noch an Koautoren!) ein Risiko mechanischer Fehlbeurteilungen.
Korrekturlesen (von Druckfahnen)
»Korrekturlesen« ist ein schwieriges bis verfängliches Wort. Mit Blick auf unsere Auftragsstruktur verstehen wir hierunter, ausgehend von proofreading, zunächst einmal das Gegenlesen von Korrekturfahnen (proofs). Diese Tätigkeit muss sich auf ein absolutes Mindestmaß an notwendigen Eingriffen in den fertig gesetzten, im Prinzip druckfertigen Text beschränken und erfordert somit eine ganz bestimmte Art des fokussierten Denkens. Zuständig dafür ist in erster Linie der (federführende) Autor. Somit lässt sich, in einem großzügigeren Sinn, proofreading als Korrekturlesen selbst geschriebener Texte interpretieren und diese Deutung auch noch bestens etwa auf das Korrekturlesen (ob nach dem Zwei- oder sogar dem Vieraugenprinzip) eigener Übersetzungen erweitern. Diese Art von Tätigkeit wiederum ist zwangsläufig Teil des in der Tabelle unter »mechanischer Bearbeitung« (mechanical editing) vorgestellten Konzepts, ohne jedoch mit diesem auch zwangsläufig deckungsgleich zu sein.