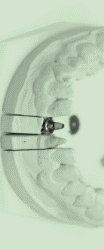4 Fehlerquellen, Stolpersteine, Fallstricke
![]()
Die Papageienfalle
(Verlust der Authentizität)
Sprachliche Authentizität gehört zu den wichtigsten Merkmalen von guten Texten. Dennoch ist ein gewisser Nachahmungstrieb integraler Bestandteil der menschlichen Sprache, und natürlich fließen beim Schreiben stets auch Vorbildeffekte ein. Der Lieblingsschriftsteller aus Jugendtagen nimmt ebenso Einfluss auf unsere Formulierungen wie der eben gelesene Zeitungsartikel. Allerdings verdanken wir diesem Nachahmungstrieb auch diverse Auswüchse, die von subtileren Effekten bis hin zum bewussten Kopieren längerer Wortfolgen reichen können.
Authentische Sprache entsteht aus idiomatischen Formulierungen, die wir aus verinnerlichtem Wissen schöpfen. Die Form sollte dabei stets dem Inhalt entsprechen. Genau dieses Verhältnis gerät unweigerlich aus dem Lot, wenn wir über kurze idiomatische Wendungen hinaus den Wortlaut von fremden Texten kopieren. Schon bei mittellangen Sätzen stehen die Chancen gut, dass dieser Wortlaut einmalig ist und auch bleiben wird.
Hätten Sie gedacht, dass ein Satz mit 29 Wörtern knapp 9 Billionen Trilliarden Möglichkeiten der Wortstellung umfasst? Klarerweise umfasst diese astronomische Zahl mit 30 Nullen fast ausschließlich Wortkombinationen, die weitgehend sinnbefreit sind. Dennoch veranschaulicht sie gut, mit welchen Größenordnungen wir es tun haben. Denn das Maß, in dem wir Wörter frei miteinander kombinieren, wird in aller Regel grob unterschätzt.
Selbst bei sinnvoll formulierten Sätzen von lediglich moderater Länge ist die Wahrscheinlichkeit von Präzedenzfällen relativ gering. Schon diese Überlegung zeigt, dass jedes Kopieren von längeren Wortfolgen sehr rasch und ganz zwangsläufig zu einem Auseinanderklaffen von Form und Inhalt führen muss. Dem Leser wiederum entgehen solche Mängel an sprachlicher Authentizität nicht. Zumindest unterschwellig empfindet er sie stets als Defizit.
Natürlich gibt es auch Ausnahmen. So müssen wir zur Beschreibung bereits etablierter Studienmethoden für eine Publikation im IMRAD-Format nicht in jedem Satz das Rad neu erfinden. Gleichzeitig können die angesprochenen Nachahmungstendenzen gerade bei solchen Manuskripten zur Falle werden. Viele Autoren legen den Grundstein zum späteren Zuschnappen der Papageienfalle schon in der frühen Bearbeitungsphase. Sie beginnen mit der Einleitung und übernehmen hierzu den Originalwortlaut ganzer Textpassagen aus der Literatur. Auf diese Weise reihen sich von Beginn an komplexe Versatzstücke aneinander.
Spätestens in der Diskussion (für die Abschnitte dazwischen gelten andere Überlegungen) setzt sich der Weg ins Verderben fort. Gerade hier zeigt sich, wie sehr deutschsprachige Autoren mit der englischen Sprache überfordert sein können. Häufig gerät die Diskussion zu einem undurchsichtigen Gefüge aus kopierten Wortlauten und eigenen komplexen Fehlervermeidungssätzen. Im Extremfall kann der Schreibfluss auf diese Art völlig zum Erliegen kommen, weil die zur Fertigstellung des Manuskripts notwendigen Eingriffe in das hochkomplexe Textgefüge immer schwieriger werden. Nicht selten wird ein Punkt erreicht, an dem der notwendige Rückbau des Manuskripts genauso viel Zeit erfordert wie die gesamte bis dahin geleistete Aufbauarbeit.
Eine gute Alternative bietet die ohnehin notwendige Vorgehensweise zur Beschreibung von Studienresultaten im gleichnamigen IMRAD-Abschnitt. Hier zwingt nämlich schon der wissenschaftliche Neuigkeitswert zu einer authentischen Sprache. Auch wenn wir uns vor Verallgemeinerungen hüten werden, ist dieser Zwang mit ein Grund, warum wir beim Verfassen von IMRAD-Manuskripten am ehesten mit den Resultaten beginnen sollten. Einmal gefunden, kann diese Authentizität in der Folge mit großem Gewinn auf Methodik, Resultate und Diskussion übertragen werden.
![]()
Die Maulwurffalle
(Verlust der perspektivischen Distanz)
Am hinderlichsten für effizientes Schreiben ist vielleicht die Tatsache, dass der Autor immer wieder das Gefühl für die richtige Distanz zum Text verliert. Dieser Distanzverlust kann in zwei Richtungen gehen: In der einen Richtung stellt sich eine Maulwurfperspektive ein, in der anderen eine Adlerperspektive. Beide Sichtweisen verleiten zu Fehlschlüssen. Insbesondere die Maulwurfperspektive bereitet vielen Autoren große Schwierigkeiten.
Aus dieser Perspektive werden Probleme größer wahrgenommen, als sie tatsächlich sind. Dieser Effekt ist bis zu einem gewissen Ausmaß normal. Voraussetzung für seine erfolgreiche Bewältigung ist, dass der Autor die Maulwurfperspektive aus eigener Kraft durchbrechen kann, ohne gleich in das andere Extrem der Adlerperspektive zu verfallen. Dieser Blickwinkel mit seinem Hang zur Oberflächlichkeit birgt nämlich stets das Risiko, dass wertvolle Maulwurfsarbeit wieder zerstört wird.
Wenn sich also angesichts der Maulwurfperspektive vorübergehend ein Gefühl der Ausweglosigkeit einstellen sollte, ist nicht immer die geistige Brechstange die Lösung der Wahl. Je nach Zeitdruck kann eine kreative Pause ergiebiger sein, denn aus einem gewissen zeitlichen Abstand werden die eigenen Maulwurfshügel auch für den Autor selbst deutlich erkennbar und ohne Gehaltverlust beseitigbar. Beispielsweise ist danach sehr spontan wieder erkennbar, wo der Text das Prinzip der minimalen Ausführlichkeit (siehe hier) verletzt.
Schon deshalb wären nach vermeintlicher Fertigstellung eines Manuskripts rund zwei Wochen Liegezeit empfehlenswert, weil eine objektive Schlussredaktion durch den Verfasser in aller Regel erst danach wieder möglich ist. Nun ist aber ein gewisser Termindruck für die Realitäten des Alltags typisch. Viele Autoren bleiben daher während der gesamten Schreibarbeit in der Maulwurffalle gefangen. Umso wichtiger ist das Entwickeln von rationalen Strategien gegen Distanzverluste. Im Idealfall findet der Autor wie ein professioneller Fotograf je nach Aufnahmezweck immer sofort das richtige Objektiv in seiner Tasche.
Im nachfolgenden Abschnitt beschreiben wir langfristige Vorteile durch gezielt von Außenstehenden eingeholte Kritik. Als Soforthilfe zum Durchbrechen der Maulwurfperspektive taugt diese Maßnahme nur bedingt. Außenstehende sprechen nämlich grundsätzlich aus der Adlerperspektive, die nicht nur inhärent oberflächlich ist, sondern auf entsprechend disponierte Personen wie eine Einladung zur Überheblichkeit wirken kann. Autoritätsverhältnisse können das Adler-Maulwurf-Gefälle noch zusätzlich verstärken.
Die Adlerperspektive von Außenstehenden hat somit für kurzfristige Rückmeldungen zwei Nachteile: Der Informationsgewinn ist erstens fragwürdig und steht zweitens nicht immer in einem gesunden Verhältnis zum zeitlichen oder emotionalen Aufwand, der mit seiner kritischen Einordnung und Relativierung einhergeht. Positiv formuliert wäre zur schnellen Befreiung aus der Maulwurffalle schon ein außerordentlich kompetenter Ansprechpartner nötig.
![]()
Die Narzissfalle
(Verlust der emotionalen Distanz)
Kritik von außen bringt langfristig enorme Qualitätsgewinne. Das Problem liegt darin, dass solche Erfahrungen kurzfristig durchaus unangenehm sein können. Wir wissen nicht, welche Ursachen dafür verantwortlich sind, dass Kritik am eigenen Sprachempfinden vom Menschen als besondere Kränkung empfunden wird. Unseres Erachtens sind Reaktionen dieser Art dermaßen allgegenwärtig zu beobachten, dass man sie besser als natürlichen Bestandteil der menschlichen Psyche akzeptieren sollte.
Diese Empfindungen schaffen aber auch Motivation und können so Lernprozesse beschleunigen. Paradoxerweise scheinen entscheidende Entwicklungsschübe in der Qualität des schriftlichen Ausdrucks nur (oder am effektivsten) über die Kränkung zu laufen. Schon deshalb sollte man diese Empfindungen bis zu einem gewissen Grad in Kauf nehmen. Und genau diese Erkenntnis führt nahtlos zu dem Schluss, dass wir Kritik am besten gleich aktiv einholen sollten.
Dabei besteht kein Anlass zur Selbstüberforderung, denn realistisch betrachtet ist es nervenschonender wie auch produktiver, wenn wir Kritik immer nur zu passenden Zeitpunkten von definierten Personen einholen. Wenn nämlich unsere Vermutung richtig ist und gewisse Lernprozesse über negative Empfindungen besonders effektiv verlaufen, können wir so zumindest Einfluss auf die Dosis nehmen.
Bei der aktiven Kritiksuche sollte die Wahl möglichst auf Personen fallen, von deren Fähigkeiten und Offenheit wir überzeugt sind. Hilfreich kann auch eine gewisse Vorahnung sein, dass die Kritik vermutlich negativ ausfallen wird. Wir benötigen diese kritischen Rückmeldungen deshalb, weil wir selbst nie mit letzter Gewissheit beurteilen können, wie transparent unsere Texte für andere sind.
Und nicht zuletzt sollten wir kritische Rückmeldungen aus ganz pragmatischen Gründen einholen: Denn je rationaler wir um Kritik bitten, umso rationaler können wir später auch mit Kritik umgehen, um die wir nicht gebeten haben. Beispielsweise lässt sich auf diese Weise eine gesunde emotionale Distanz gegenüber Rezensenten schaffen. Aus diesem Abstand lassen sich Kritikpunkte objektiver einschätzen, und diese Objektivität führt wiederum zu besseren Ergebnissen beim Überarbeiten von Manuskripten.
![]()
Die Logosfalle
(Verlust der Natürlichkeit)
Das Bedeutungsfeld des altgriechischen Wortes Logos ist heute schwer nachvollziehbar und illustriert gerade deshalb ein tief verwurzeltes Missverständnis. Die möglichen Bedeutungen reichen von Wort über Rede und Vernunft bis hin zu einer Reihe von ganz speziellen Bedeutungen. Sprache ist aber ein wesentlicher Aspekt. All dies hat trotz der offensichtlichen Etymologie mit unserer heutigen Auffassung von naturwissenschaftlicher Logik sehr wenig zu tun.
Nun ist das Bestreben vieler deutschsprachiger Autoren nach naturwissenschaftlicher Exaktheit und Redlichkeit überaus ehrenwert. Allerdings nährt diese Haltung oft einen Irrglauben, wonach die Gesetze der Mathematik letztlich auch das Wesen der Sprache bestimmen. Sprache ist aber kein besonders gutes Medium zur Beschreibung logischer Sachverhalte. Die Erkenntnis, dass sich oft die einfachsten Dinge nicht angemessen beschreiben lassen, stellt sich rasch ein, wenn wir etwa in Worten zu beschreiben versuchen, wie wir unsere Schuhbänder schnüren.
Viele deutschsprachige Autoren bauen ihre englischen Sätze unter Einsatz beträchtlicher geistiger Energien zu uneinnehmbaren Festungen aus. Dahinter steht die Annahme, dass die Beschreibung von komplexer Materie ebenso komplexe Sätze erfordert und die Vorgehensweise eines Konstrukteurs positiven Einfluss auf die Textqualität nehmen muss. In Wirklichkeit wirken solche Texte rasch überladen und gekünstelt, weil ihre komplizierten Strukturen dauernd irgendwelche Konventionen der Fremdsprache verletzen.
Dabei würden viele dieser Autoren durchaus über die sprachlichen Möglichkeiten für einfachere Lösungen verfügen. Der erste Schritt ist getan, sobald wir uns von der Vorstellung befreit haben, Sprache sei eine gute Grundlage zur Beschreibung von naturwissenschaftlichen Sachverhalten. Bessere Resultate beim Schreiben lassen sich mit der Haltung erzielen, dass nicht der mögliche Nutzen von Sprache optimiert, sondern der mögliche Schaden durch Sprache begrenzt werden soll. Diese Optimierung zum Einfacheren kann mehr Denkarbeit erfordern, bringt aber enorme Gewinne an Natürlichkeit und Authentizität.
![]()
Die Autoritätsfalle
(Verlust der Kritikfähigkeit)
Große Verunsicherungen der heutigen Gesellschaft im Umgang mit Autoritäten machen auch vor der Sprache nicht Halt. Bekanntlich gibt es gute (autoritative) und schlechte (autoritäre) Autoritäten. Während früher Unterordnung unter beide Formen der Autorität gang und gäbe war, besteht heute eine Tendenz, überhaupt keine Autoritäten mehr anzuerkennen.
Durch die zunehmende Demokratisierung von Publikationsformen und schriftlichen Kommunikationskanälen sind wir heute einer wachsenden Flut von unredigierten Texten ausgesetzt. Viele dieser Darbietungen sind nicht nur inhaltlich, sondern auch in ihrer Form überaus fragwürdig. Ihre Rückwirkungen auf die Sprache insgesamt sind noch gar nicht absehbar. Wir können nicht wollen, dass solide Publikationstexte sprachlich gesehen das Niveau von unredigierten Leserbriefen in Massenblättern erreichen. Wenn wir Entwicklungen dieser Art verhindern wollen, müssen wir zumindest noch die guten Autoritäten akzeptieren können.
Umgekehrt benötigen wir zu jedem Zeitpunkt des Schreibens eine intakte Kritikfähigkeit. Anders ausgedrückt: Gleichgültig welche Lebensanschauung man sonst hat, verbietet sich beim Schreiben eine Mentalität des militärischen Gehorsams. Denn die meisten Regeln, an denen wir uns beim Schreiben orientieren, haben nur relativen Charakter. Selbst Regeln, von deren Allgemeingültigkeit wir absolut überzeugt sind, lassen sich immer nur neunundneunzig Mal anwenden und scheitern beim hundertsten Mal kläglich.
Selbst wissenschaftliche Autoren denken immer wieder einmal in Kategorien, die sie noch aus dem Sprachunterricht im Gymnasium kennen. Drei Begriffe kommen dabei besonders oft zur Sprache: Rechtschreibung, Grammatik und Stil. Diese Dreiteilung ist in der Praxis nicht besonders hilfreich, verdeutlicht aber gut das steile Gefälle in der Härte von Regeln.
Rechtschreibregeln sollten wir möglichst nicht (oder nur in absoluten Ausnahmefällen) bewusst brechen, da auf dieser Ebene ein fassbares Regelwerk noch existiert. Das weite Feld der Grammatik umfasst bereits harte und weiche Regeln. Grammatikregeln sind durchaus nicht frei von Unschärfen. Spätestens in Fragen des Stils erreichen diese Unschärfen dann eine Größenordnung, die eher nach Regeln der Vernunft verlangt als nach Regeln von Autoritäten.
![]()
Die Kippfalle
(Verlust des Gleichgewichts)
Lineare Ausdrucksformen leben von einer gewissen Abwechslung. Sie bleiben nur im Gleichgewicht, wenn ein harmonisches Wechselspiel zwischen konträren Elementen herrscht. In der Musik ist dieses Wechselspiel zwischen Bewegung und Ruhe allgegenwärtig. In der Sprache ist der Grundsatz weniger gut definiert, aber dennoch stets präsent. Bei völliger Missachtung führen die negativen Effekte in Summe zu einer deutlichen »Schlagseite« im schriftlichen Ausdruck.
Unzählige Texte zeigen gewisse Balancestörungen, und nur wenige Texte sind weitestgehend frei davon. Oft sind es nicht gewachsene Präferenzen des Autors, die zur Schlagseite führen, sondern kurzfristige Verzerrungen in seiner Wahrnehmung. So drohen Balancestörungen immer dann, wenn ein Autor erkannte Schwächen überkompensiert. Denn jede Erkenntnis von eigenen Schwächen (sei es durch Hinweise von außen oder durch eigene Reflexion) birgt unmittelbar den Keim von Übertreibungen in die Gegenrichtung.
Ähnliche Effekte entstehen in der Begeisterung über sprachliche Aha-Erlebnisse. Wir erschließen ja kontinuierlich neues Sprachwissen. Die Versuchung ist groß, dieses (zunächst oberflächliche) Wissen auch sofort anzuwenden. Gern lassen wir daher Ausdrucksformen in unsere Texte einfließen, die wir in Wirklichkeit gerade erst (und oft in völlig anderen Zusammenhängen) aufgeschnappt haben. Dies ist in aller Regel keine besonders gute Idee, weil wir nicht mehr aus verinnerlichtem Wissen schöpfen und die übernommene Form den zu vermittelnden Inhalt aus dieser kurzfristigen Perspektive nur selten mit dem gebotenen Maß an Authentizität abbilden wird.
![]()
Die Zugzwangfalle
(Verlust von Alternativen)
Gewisse Elemente des schriftlichen Ausdrucks werden immer wieder kontrovers diskutiert. Oft ist dabei noch das geringere Problem, dass man kein Patentrezept für den täglichen Sprachgebrauch findet. Wesentlich schwerer wiegt die Tatsache, dass man sich bei Festlegung auf eine bestimmte Variante zwangsläufig der Kritik öffnet. Was der eine als legitime Vermeidung potenziell beleidigender Ausdrücke sieht, belächelt der andere als Political Correctness. Andere Formen des Ausdrucks kann man je nach Standpunkt als emanzipatorisches Anliegen oder aber als ungrammatisch begreifen.
Typisch für diese ausweglosen Situationen ist, dass alle Kontrahenten bis an die Zähne mit Argumenten bewaffnet ins Feld ziehen, sodass sich jede gewählte Variante je nach Standpunkt trefflich verteufeln oder auch verteidigen lässt. Denn natürlich führen Sensibilitäten von Frauen im Deutschen wie auch Englischen zu ungrammatischen Phänomenen (Wortbildung, Pronomina, Numerus). Genauso ist aber das Argument, dass alle Frauen bei männlichen Formen automatisch mit gemeint sein sollen, nicht wirklich überzeugend.
Beide Seiten der Medaille umfassen also Elemente, die man nicht einfach wegdiskutieren kann. Ähnliche Überlegungen gelten für die meisten anderen Streitpunkte, die zum Alternativenverlust führen können. Beispielsweise kann man darüber streiten, inwieweit man Ausdrücke meiden sollte, wenn sie unschöne Fremdassoziationen oder Sensibilitäten hervorrufen könnten, während alle Alternativen der Wortwahl aus rein sprachlichen Gründen fragwürdig oder unästhetisch sind. Dies ist nur ein Beispiel für mögliche Szenarien.
Alle diese Spannungsfelder sind potenzielle Minenfelder. Auch erfahrene Autoren können große Mühe im Umgang mit diesen Phänomenen haben. Angesichts des Alternativenverlusts, mit dem wir in solchen Zugzwangfallen konfrontiert sind, würden wir manchmal am liebsten resignieren. Und Beispiele der genannten Art bilden nur die Spitze des Eisbergs. Zahlreiche andere Beispiele für scheinbar ausweglose Zugzwangsituationen existieren auch auf weniger kontroversen Ebenen der Sprache.
Der wichtigste Schritt in die richtige Richtung besteht darin, dass man die Ausweglosigkeit überhaupt einmal erkennt. Erst auf dieser Grundlage können wir einen Modus vivendi entwickeln, der unseren individuellen Bedürfnissen als Autor gerecht wird. Erst dieses Bewusstsein, das Problem hinreichend analysiert und durchschaut zu haben, befreit uns von dem latenten Gefühl, in einem ungelösten Problem gefangen zu sein. Die Analyse sollte gründlich genug sein, dass wir uns dezidierten Meinungen von der Gegenseite souverän gewachsen fühlen. Erst an diesem Punkt haben wir das Problem, wenn schon nicht gelöst, so zumindest bewältigt.
Als Übersetzer sind wir insofern im Vorteil, als wir kontinuierlich mit zahlreichen sehr unterschiedlichen Texten konfrontiert sind. Diese Exposition führt unweigerlich zu der Erkenntnis, dass jeder Text letztlich anders gelagert ist, sodass die individuelle Abwägung im Einzelfall wichtiger ist als jede Allgemeingültigkeit von Regeln (auch wenn diese noch so nachdrücklich postuliert werden).
© 2009-07-14 Wilfried Preinfalk. Alle Rechte vorbehalten.