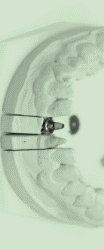Wissenschaftliche Publikationen:
Sieben gute Gründe,
warum wir sinnvoll für Sie arbeiten können
(1) Erfahrung mit Schwächen und deren Überwindung. Im Lauf der Jahre konnten wir Hunderte von wissenschaftlichen Publikationen umsetzen. Diese breite Exposition hat uns (aus einem speziellen Blickwinkel) tiefe Einblicke in wiederkehrende Phänomene der Textpräsentation vermittelt. Wir wissen genau, welche Schwächen verbreitet sind und wie man sie überwindet. Nichts liegt uns ferner als sprachpflegerische Ambitionen der kleinlichen Art. Vielmehr bringen wir Wissen ein, das aus den Notwendigkeiten unserer täglichen Arbeit gewachsen ist.
(2) Spezialisten für das letzte Wegstück. Unsere Tätigkeit umfasst manche, aber nicht alle Elemente des Schreibens von Originaltexten. Für einen Übersetzer oder Redakteur ist der Weg vom Gedanken zum Wort doch wesentlich kürzer als für den Autor. Jedoch konnten wir gerade auf diesem letzten Wegstück der Umsetzung viel mehr Erfahrung sammeln als die meisten Autoren. Unsere Perspektive mag also eingeschränkt sein, bietet aber durch die schiere Masse an bearbeiteten Texten einen reichen Fundus an Erfahrungen und Kenntnissen.
(3) Profunde Textrezeption. Übersetzer müssen bei ihrer Tätigkeit ständig interpretieren. Folgerichtig ist der Übersetzer oft der einzige Mensch, der die Tiefe eines Textes gründlich auslotet. Dies hat nichts mit fachlicher Autorität zu tun. Wertungen auf dieser Ebene würden wir uns niemals anmaßen. Der Grund liegt vielmehr im Wesen unserer Tätigkeit, die Schwächen in der Präsentation von Inhalten schonungslos offenbart. Eine ähnlich intensive Auseinandersetzung mit Texten ist durch normales Lesen nicht (oder nur schwer) zu erreichen. Gute Übersetzungen oder Redaktionsarbeiten können daher die Absichten des Verfassers oft besser verdeutlichen als der Originaltext.
(4) Zielgruppengerechte Textrezeption. Ein universelles Prinzip des medizinischen Publikationswesens besteht darin, dass Manuskripte nicht nur Spezialisten für den behandelten Themenkreis zugänglich sein sollen. Vielmehr sollte die Materie so dargeboten werden, dass auch andere Spezialisten und interessierte Außenstehende profitieren können. Ein Passus dieses Inhalts findet sich in den Autorenrichtlinien von unzähligen Journalen. Diesem Profil einer interessierten Randgruppe entsprechen wir in vieler Hinsicht optimal. Aus dieser Perspektive können wir verschiedensten Autoren regelmäßig dabei helfen, eine gewisse »Betriebsblindheit« zu durchbrechen, die uns alle beim Verfassen von Originaltexten früher oder später einholt.
(5) Transparenz und Lesefreundlichkeit. Diese Qualitäten der sprachlichen Präsentation sollte jeder Autor stets als vorrangiges Ziel betrachten. Sie sind auch der rote Faden im Autorenratgeber auf unseren Internetseiten (Bereich »Science Writing«). Unsere Arbeit lässt sich als Hilfe zur Beschleunigung von Rezensionsprozessen ebenso auffassen wie als Vorkehrung gegen Kommunikationsdefizite. Für ein Höchstmaß an Klarheit und Lesefreundlichkeit spricht aber noch ein viel einfacherer Grund: Respekt vor dem Leser.
(6) Beschleunigung von Rezensionsprozessen. Im Peer-review-Verfahren werden Wünsche zur sprachlichen Überarbeitung oft schlecht argumentiert. In vielen Fällen ist nicht einmal ersichtlich, ob einzelne Kritikpunkte eines Begutachters auf die sprachliche Präsentation oder die Datenpräsentation im engsten Sinn abheben. Das Potenzial für unterschwellige Missverständnisse ist nahezu unerschöpflich. Schon deshalb ist es ein Gewinn, wenn Manuskripte bereits vor ihrer Ersteinreichung gründlich von einem Sprachexperten mit einschlägigen Spezialkenntnissen bearbeitet werden. Nur so hat der Autor eine gewisse Garantie, dass Unwägbarkeiten dieser Art nicht auf Monate oder Jahre hinaus die Publikation der Arbeit verzögen werden.
(7) Englisch, Englisch, Englisch. Englische Texte von Autoren aus dem deutschsprachigen Raum können bei oberflächlicher Betrachtung durchaus korrekt wirken und dennoch bei genauer Lektüre große Mühe bereiten, voller Unschärfen stecken und erhebliche Verwirrung stiften. Trotzdem gibt es gute Gründe, warum viele Autoren ihre Manuskripte nicht etwa auf Deutsch schreiben und dann übersetzen lassen, sondern lieber gleich auf Englisch verfassen. Nun stellen medizinische Fachjournale mit internationalen Autoren wesentlich geringere Anforderungen an die Druckreife von Artikeln als andere Bereiche des Verlagswesens. Viele Aspekte dieser hohen Toleranz verdienen Wertschätzung. Nachteilig ist, dass sie zu fundamentalen Missverständnissen führen können und die Tücken der entstehenden Kommunikationsdefizite schnell einmal unterschätzt werden. Hinzu kommt, dass im akademischen Umfeld oft Fähigkeiten im Umgang mit der englischen Bildungs- und Schriftsprache vorausgesetzt werden, die unrealistisch sind und daher kritisch hinterfragt werden sollten.
© 2009-07-14 Wilfried Preinfalk. Alle Rechte vorbehalten.